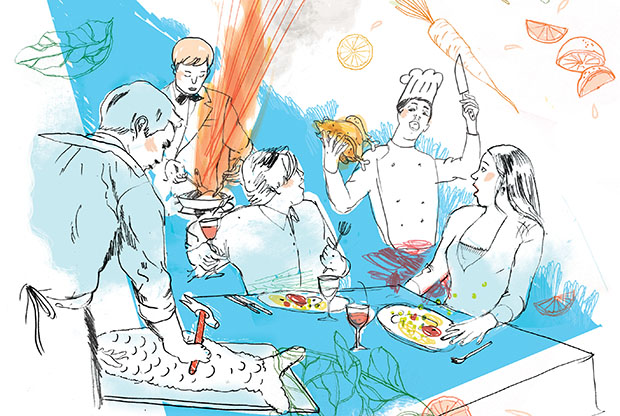Drama bei Tisch
Tranchierfräulein, Suppensiphon und Mörsergrill: Arbeiten „am Gast“ hat viele Formen. Stammbaumkarotten mit Toupet kommen in den Fleischwolf, flüssiger Stickstoff auf den Eiswagen, heiße Steine unter die Langustinen. Und Flambieren geht über Studieren.
Text Anna Burghardt ∙ Illustration Myriam Heinzel
Ohne ein weiteres Wort, als ob nichts passiert wäre, verlassen die beiden Köche zügig den Tisch. Der wie ein Schlachtfeld aussieht. Teile von dünnwandigen Schokoladehohlkugeln liegen herum, pastose Spritzer in dunklem Rot und Gelb dazwischen; überall verstreut ist krümelig gefrorenes Eis, etwas, das nach Zuckerwatte aussieht. Dabei hat alles so ordentlich angefangen – mit einem frisch aufgedeckten Kunststofftischtuch. Darauf zwei bowlingkugelgroße Schokoladenbälle platziert, in die Öffnung flüssigen Stickstoff geleert. Auf das Tischtuch mit Löffeln sorgfältig dekorative Linien geträufelt, „Preiselbeersirup“, Tupfer gesetzt, „Süßkartoffel-Zitrone“, Schlieren gezogen, „Schwarzbierreduktion“. Mehr wird nicht gesprochen. Dann heben die servierenden Köche die Schokoladenbälle synchron hoch – und lassen sie fallen. Das Dessert ist angerichtet. Die Gäste verharren einen Moment in Schockstarre. Und greifen dann zu ihren Löffeln, um den Saustall auf ihrem Tisch aufzuräumen.
Was unter Grant Achatz im Alinea in Chicago als Dessert konzipiert wurde – in einigen Variationen, unter anderem mit weißer Schokolade – ist als Idee mittlerweile um die Welt gegangen. Etwa ins Uma in Barcelona, wo man nicht nur ebenfalls ein vom Tischtuch zu essendes Dessert aus Schokohohlkugeln anbietet, sondern auch einen Wagen zu Tisch fährt, der erst ein paar Minuten später zum Eiswagen wird. Nämlich dann, wenn flüssiger Stickstoff seine Dienste getan und Vanillesauce zum frischesten Eis gefroren hat, das man als Gast verlangen kann. Im Dinner by Heston Blumenthal in London ist ein solcher Eiswagen schon ein Klassiker. Eine Maßanfertigung aus weißem Corian, mit einer Küchenmaschine samt Kurbelrad bestückt, verschiedene Toppings und kleine Stanitzel darauf platziert. Ein Kellner gießt zunächst kunstvoll aus beachtlicher Höhe flüssige Vanillemasse in die Schüssel der Küchenmaschine, leert dann aus ebensolcher Höhe flüssigen Stickstoff aus einer Thermoskanne nach und beginnt am Rad der Küchenmaschine zu drehen. Fragt höflich, ob es Schokoladenflocken oder lieber bunte zuckerüberzogene Anissamen als Draufgabe sein sollen, und noch während man überlegt, präsentiert er das wie von Zauberhand cremig gefrorene Eis in der Rührschüssel.
Der flüssige Stickstoff mit seinen rund 200 Minusgraden hat gewissermaßen die Flambierflamme abgelöst, die jahrzehntelang dazu gedient hat, den Gästen eine finale Show zu bieten. Etwa wenn Crêpes Suzette, der Flambierklassiker, auf einem an den Tisch herangerollten Wagen namens Guéridon mit brennendem Orangenlikör fertiggestellt wurden. Oder der Café Diable: In Kurzform (und um nur eine der möglichen Zubereitungsarten zu nennen) werden dafür, ebenfalls auf einem Guéridon neben dem Tisch, Weinbrand und Orangenlikör mit Zucker erhitzt und vorsichtig über eine nunmehr spektakulär brennende Orangenspirale – je länger, desto besser – in den Kaffee geleert. Café Diable erlebt übrigens gerade in Japan ein Revival, wo man vor allem auch mit der Kunstfertigkeit des Orangenspiralen-Schneidens in der Luft zu punkten versucht. Werner Matt, die österreichische Kochlegende, weiß auch von flambierter Lachsforelle in Salzkruste zu berichten, die er im Restaurant Prinz Eugen auffuhr: Vor den Gästen wurde die Kruste auf einem Silbertablett angeschlagen, „sodass sie Sprünge hatte, aber noch ganz war“, mit Pernod (Anisaroma!) übergossen und angezündet. „Das macht wirklich kaum mehr wer.“
Solche anachronistischen Formen des Service oder Kochens am Gast, wie der etwas hölzerne Fachterminus für das lautet, was sich auf Englisch „tableside action“ nennt, haben ihre Hochs und Tiefs erlebt (von Raclette und Fondue soll hier nicht die Rede sein). Vielerorts sind sie verschwunden, anderswo wurden sie bewahrt, wieder anderswo werden sie neu etabliert. Es sind vor allem Luxusadressen wie The Grill im The Dorchester in London, das Hamburger Vier Jahreszeiten oder das Suvretta House in St. Moritz, wo Braten, Beef Tatar oder Crêpes Suzette noch immer vom Wagen kommen, auf ebendiesem tranchiert, gemischt oder flambiert werden. Im Plaza am Wiener Ring, wo einst Werner Matt im La Scala kochte, möchte Matt-Schüler Erich Freund ebenfalls das Flambieren und auch das Tranchieren am Gast wiederbeleben, „weil es hierher passt und weil es kaum mehr jemand macht“. Im hauseigenen Fundus spürte er silberne Tischbrenner und kupferne Crêpes-Suzette-Pfannen auf sowie einen Fleischwagen mit ausklappbarem silbernen Tellerhalter, auf dem nun sonntags die Hochrippe zu den Gästen rollt. Ob wohl eines Tages im Emilé, wie das Restaurant im Plaza heute heißt, auch Zabaione am Tisch gekocht werden wird? Davon weiß jedenfalls Werner Matt zu berichten: „Die haben wir auf einem Wagen vor den Augen der Gäste in Achterschlingen geschlagen, dazu hat immer der Pianist gespielt, natürlich genau im Takt.“
War die Hitze in Form eines silbernen oder kupfernen Brenners anno dazumal neben dem Tisch platziert, auf einem Guéridon, so ist sie heute immer öfter auf dem Tisch zu finden. Miniaturgriller sind weltweit in den besten Restaurants zu finden. So etwa bei Joachim Wissler im Vendôme auf Schloss Bensberg. Der Träger der Ehren-Trophée-Gourmet 2016 ist generell zwar nicht für ausufernde Spielchen bei Tisch bekannt, ließ aber doch auch schon den Grill auffahren: in Form eines dazu umfunktionierten Mörsers, auf dem eine Langustine unter Zitronengrasbeduftung zart gegart wurde, bevor man sie mit einem Jakobsmuschel-Chip und grüner Walnusscreme anrichtete. Wisslers deutscher Kollege Christian Jürgens vom Überfahrt am Tegernsee setzt indes in ein und demselben Menü auch schon gleich dreimal auf Kochgerätschaft am Gast: Grüner Spargel wird auf einem spargelgrünen Minitischgrill gegart, so weit, so unauffällig. Schon spektakulärer ist das Reh, das auf dem Tisch in glühender Holzkohle gegart wird, von Spitzkohlblättern geschützt. Und für den Hong Kong Crayfish Tea lässt Jürgens eine Glaskolbenkanne samt Flamme auf den Tisch stellen. Im unteren Teil der Maschine, die an den Chemieunterricht erinnert, befindet sich ein klarer Langostino-Sud, während im oberen Teil, dem Filter, verschiedene Aromate wie Kaffirlimettenblätter, geröstete, gemahlene Langostinoschalen, Thai-Basilikum und verschiedene Gemüse warten, so beschreibt es der Koch. „Durch das Erhitzen des Langostino-Fonds bildet sich Dampf, der in den Filter aufsteigt, dort kondensiert und sich mit allen Zutaten vermischt. Dadurch nimmt der Fond den Geschmack der Zutaten an und färbt sich rot. Danach fließt der Fond wieder zurück in die Kanne. Abschließend wird er in die vorbereiteten Teller mit Langostino-Einlage gegossen und sofort heiß serviert.“ Mit einer solchen „Langosta Destilada“ sorgte bei der „Madrid Fusión“ 2014 schon Pedro Subijana vom Restaurant Akelarre in San Sebastián für Furore, und „Tableside“-Siphongerichte wie dieses finden sich in weiteren Lokalen, etwa dem Maaemo in Oslo, wo man mit hochintensiven getrockneten Waldpilzen, Siphon und Flamme hantiert.
Kochen am Gast, das funktioniert auch ohne Flamme bei Tisch: Da wären etwa die Carabineros, rote Riesengarnelen, welche die Roca-Brüder im spanischen Girona erst vor den Augen der Gäste garen ließen: in einer Schale mit Deckel, unten heiße Steine, darüber ein winziger Rost, wo gottergeben die Carabineros auf den Saunaaufguss mit heißem Manzanilla warteten. Deckel drauf, ein paar Minuten im heißen Dampf lassen, essen. Mit heißen Steinen bei Tisch hantierte man auch schon im Steirereck und im Mühltalhof, genauer gesagt, mit heißen Salzsteinen, auf denen Fischfilets zu liegen kamen. Auch bei Heinz Reitbauers berühmtem Saibling im Bienenwachs wird am Tisch zwar Hitze, aber keine Flamme eingesetzt: Saiblingsfilets werden in einem eigens angefertigten Rahmen platziert, die Zwischenräume vom Service mit flüssigem Bienenwachs ausgegossen. Nach einigen Minuten ist der Fisch glasig gegart, allein durch die Wärme des Wachses, und wird mit Strünken von Gelben Rüben sowie Gelbe-Rüben-Gelee mit Bienenwabenabdruck serviert. Um Kühle geht es hingegen im Tannenhof in St. Anton, wo der britische Küchenchef James Baron sich mit alpinen Traditionen auseinandersetzt und Butter mit einer alten Buttermaschine bei Tisch schlagen lässt.
Ein Restaurant, aus dem Action bei Tisch – oder soll man es Drama nennen? – nicht wegzudenken ist, ist das Eleven Madison Park in Manhattan. Legendär ist hier nicht nur die pralle Schweinsblase in einer Kupferpfanne, aus der vor den Gästen je nach Saison Spargel oder Stangensellerie geholt werden. Daniel Humm schickt auch Baked Alaska flambé zu Tisch, hierzulande besser bekannt als Omelette Surprise. Stör wird unter einer Cloche geräuchert, Reh – siehe Christian Jürgens – auf dem Tisch in ausgehöhlter Holzkohle gegart. Vor allem aber ist es das Karottentatar, das unter weitgereisten Essern noch immer für Gesprächsstoff sorgt. Für dieses Signature Dish wird ein haushaltsüblicher Fleischwolf an die Tischkante geschraubt. Die Tatarbeigaben wie Senfkörner, Sonnenblumenkerne oder gehackter Ingwer sind auf einer speziellen Holzplatte vorbereitet. Den großen Auftritt haben dann zwei Karotten, die, wie man erfährt, von Daniel Humms Vertrauensgemüsemann Alex Paffenroth stammen. Ungewöhnlich leuchtend, mit offenkundig ausgeklügelter Pseudoschlampigkeit geschält und mit irritierend dichtem Grün bestückt. Was weiß man schon von der Physiognomie New Yorker Stammbaumkarotten, könnte man meinen, die Wahrheit ist jedoch profaner: Die Karotten tragen ein Toupet – mit weißem Küchengarn wurde Zusatzgrün an den schütteren eigenen Stängeln fixiert. Die Karotten werden durch den Fleischwolf gedreht, das Tatar landet zunächst auf einem Blatt Papier und dann auf dem Holzteller zur Weiterverarbeitung nach Gutdünken.
Beef Tatar könnte prinzipiell ein Paradebeispiel für das gewiss zeitintensive Kochen am Gast sein. Das Dstrikt im Ritz am Wiener Schubertring macht das noch vor: die Condiments extra, Cognac und Ei ebenfalls – und bis man im Gespräch mit dem Service seine persönliche Mischung definiert und mehrfach probegekostet hat, dauert es durchaus. Beef Tatar sei ansonsten in Wien größtenteils unzumutbar, meint Frank Bläuel, der als Patron des Tulbingerkogel im Wienerwald noch die alte Schule hochleben lässt, mit Beef Tatar am Tisch und Rindfleischwagen mit Silberhaube. Geschabt werde das rohe Fleisch sowieso kaum noch wo, „viele drehen überhaupt gleich alle Zutaten durch den Fleischwolf“, und gewürzt sei es auch schon. Bläuel, als Kulinarhistoriker aktiv, weiß vom Hotel Meissl & Schadn am Neuen Markt zu erzählen, wo im Wagen 24 Rindfleischarten angeboten wurden, und er beobachtet als vielreisender Esser mit Missbehagen den Niedergang des Begriffs „am Gast“ in der einstigen Hochburg Paris. „Das ist dort leider eine Katastrophe. Da rennt einer zum versteckten Serviertisch, rührt um, auf einmal brennt was, fertig.“ Das sei nicht das, was man unter Service am Gast versteht. „Entweder sie missverstehen diese Traditionen oder sie negieren sie.“
Zum Begriff „am Gast“ zählt auch das Tranchieren, eine Kunst, die – das darf man diagnostizieren – schon einmal üppiger geblüht hat als heute. Im 17. Jahrhundert änderte sich, ausgehend von Italien, auch im Alpenraum das Tafelverhalten in italophilen Adelshaushalten. Bei festlichen Tafeln zerlegte der Vorschneider, der Trinciante, vor den Augen der Gäste das Fleisch. Im Barock waren es auch Frauen, die kunstvoll mit langen Messern hantierten: die Tranchierfräulein. Junge Adelige sollten das Tranchieren ebenso lernen wie Fechten oder Tanzen, und zahlreiche gedruckte Anleitungen waren ihnen zu Diensten. Es kam zu spektakulären Vorführungen, etwa wenn ein ganzes Huhn, nur auf eine Tranchiergabel gespießt, in der Luft zerschnitten wurde.
Diese Fertigkeit besitzt heute kaum noch mehr jemand. „Das Tranchieren erfordert wirklich profundes Wissen“, sagt dazu Karl Obauer, der Ende der Sechziger gelernt hat, also noch zu Zeiten des klassischen Kochens am Gast. „Damals ist noch einiges am Gast passiert, in Bad Gastein zum Beispiel.“ Und auch in Frankreich sammelten er und sein Bruder Rudolf viele Erfahrungen – als Gäste. Die Tranchierwägen mit Spanferkel, Ziegenkeulen oder großen Fischen seien damals zwar schon eher eine Rarität gewesen, Karl Obauer hat die Zeit vor dem so genannten Tellerservice, der erst mit der Nouvelle Cuisine gekommen ist, aber durchaus noch miterlebt: Fleisch und Fisch, vor den Gästen mit Könnerschaft tranchiert und filetiert. Jenen Küchenchefs, die solche Traditionen wiederbeleben wollen, rät er, es nur dann zu versuchen, wenn auch das entsprechende Servicepersonal da ist. „Das braucht einen hohen Grad an Technik, man muss wissen, wie so ein Stück Fleisch aufgebaut ist. Sonst schaut es auf dem Tisch aus wie auf einem Schlachtfeld.“ Was wiederum andere, siehe Alinea-Dessert, durchaus anstreben.