Die fabelhafte Dingwelt des Kochens
In der Küche treffen Fetischobjekt und Gebrauchsgegenstand aufeinander: Corinne Mynatts Projekt Tools for Food zeigt die irrwitzige Bandbreite an weltweiten Kochutensilien – die in Restaurants heute gern die Grenze zum Gastraum überschreiten.
Mit der Knoblauchpresse fing alles an. Auf einem Pariser Flohmarkt stieß Corinne Mynatt auf dieses in Österreich vollkommen alltägliche Werkzeug – ihr war es bis dahin unbekannt. Und sie empfindet es als großes Glück, die Presse-ail et dénoyauteur aus Aluminiumguss überhaupt gefunden zu haben: „Es wird immer schwieriger, solche einfachen Kochgegenstände zu entdecken. Sie werden heute nur mehr als nutzloses Gerümpel eingestuft, sodass sich die Leute nicht einmal mehr die Mühe machen, sie auf einen Markt mitzubringen und zu verkaufen.“ Mynatt, in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geboren und in London lebend, war im Jahr 2005 gerade dabei, ihren beruflichen Werdegang und ihre Interessen neu zu überdenken. Sie hatte Fine Arts und Design in New York und am Central Saint Martins in London studiert, einen Master in Contextual Design in Eindhoven gemacht und als Kuratorin, Filmemacherin und Beraterin im Kunst- und Designkontext gearbeitet. Die simple Knoblauchpresse sollte sich als Anstoß zu einem großen Projekt entwickeln, das vorerst in einem Buch mündete, Tools for Food. The stories behind objects that influence how and what we eat (bisher auf Englisch, Japanisch und Italienisch erschienen).
„Diese Presse schien alles in sich zu vereinen: die Liebe zum Essen und Kochen, meine Faszination für Design sowie Orte, an denen sich diese Dinge treffen.“ Corinne Mynatt begann, Informationen zur Knoblauchpresse zusammenzutragen und Ausschau nach weiteren Kochwerkzeugen aus verschiedenen Kulturen samt ihren Hintergrundgeschichten zu halten. Fündig wurde sie teils in Bibliotheken wie der British Library oder Datenbanken wie dem Digital Museum of Sweden, teils bei Handwerkerinnen und Köchen, teils an Orten des alltäglichen Lebens, etwa in Tokios Kappabashi Kitchen Street (ihre erste Reise im Zuge der Recherche führte sie nach Japan). Das Thema ist ein schier unendliches Feld, wie ihr sehr bald klar wurde. In ihrem Buch stellt Mynatt daher auch nur einen Bruchteil der Objekte vor, die ihr im Laufe ihrer jahrelangen Suche begegnen sollten. Sie besitzt sie übrigens nur zum Teil selbst; viele Dinge gehören indes in Form eines Fotos und einer Datei mit Informationen zu ihrem Fundus. Elektrische Geräte sowie, „mit wenigen, allzu verlockenden“ Ausnahmen, Gegenstände der Tafelkultur („ein viel zu großes eigenes Forschungsgebiet“) klammerte Corinne Mynatt dabei aus – „vielleicht einmal für ein weiteres Buch?“ Wobei die Grenzen zwischen Koch- und Tafelkulturobjekten in der Gastronomie heute gern überschritten werden, indem Geräte und Werkzeuge für die Zubereitung, ob zweckentfremdet oder nicht, den Gastraum betreten dürfen. Stichwort Beef Tatar, das in einer kleinen gusseisernen Bratform zu Tisch kommt, obwohl es in seiner Natur liegt, dass es keinerlei Hitze sieht, oder knusprige Calamari, die in kleinen Frittierkörbchen serviert werden.
Corinne Mynatts Fundus und ihr Buch sind eine kompakte Untermauerung der These, dass uns erst das Kochen zum Menschen macht. Und zum menschlichen Wesen gehört in vielen Fällen der Hang zum Schwachwerden bei Gegenständen, die damit werben, das Leben noch einfacher zu machen, Helferleins, die mit der Hoffnung auf Entlastung hausieren gehen. Kitschzeug und Gadgets sagt Corinne Mynatt dazu – und Gadgets haben in Tools for Food keinen Platz. „Das Leben sollte einfach sein. Gadgets sind überflüssig.“ Manchmal bezieht sie sich auf ein Gerät, das ihre Mutter in den 1990er-Jahren hatte (und das noch immer vertrieben wird): den „Grapefruiter“. „Mit diesem Gerät konnte man Keile aus einer Grapefruit schneiden. Der größte Schnickschnack, den man sich vorstellen kann, lauter Plastik und denkbar lebensmittelspezifisch. Was wäre so falsch an einem Messer und einem Löffel gewesen? Ironischerweise konnten meine Eltern das Ding irgendwann nicht mehr benutzen, weil man wegen bestimmter Medikamente keine Grapefruits essen darf. Es lebe die Einfachheit!“
Utensilien wie der Grapefruiter oder, weniger „gadgetig“, der Eiskugelformer, der Fetttrenner, das Canelé-Förmchen und die Flotte Lotte stehen für eine Entwicklung, die laut Corinne Mynatt vor 7.000 Jahren begonnen hat und seit fünf Jahrhunderten deutlich steiler verlaufen ist. „Die größten Fortschritte in der Schaffung von Kochgegenständen wurden dann in den vergangenen zwei Jahrhunderten erzielt“, berichtet sie, das habe zu einem beträchtlichen Teil mit der industriellen Revolution zu tun. Mit der Massenproduktion etablierte sich im 19. Jahrhundert eine Batterie de cuisine (der Begriff Batterie ist tatsächlich militärisch konnotiert zu verstehen), also ein Sortiment an Pfannen, Töpfen, Backformen, Kochlöffeln, Messern et cetera, das in Haushalten und Profiküchen als Standard galt. Heute werden in Küchen außerdem Thermomix und Sous-vide-Garer, Microplane-Reibe und Fleischthermometer als Geschütze aufgefahren.
An der Wahl des Materials und der Ausprägung des Designs ist, so Mynatt, oft der Zustand von Wirtschaft und Weltpolitik abzulesen. So verzögerte etwa der Amerikanische Bürgerkrieg in den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts den Entwicklungsschub in Sachen Material und Design, den Großbritannien und das europäische Festland während dieser Zeit bereits verzeichneten. Die Industriedesignbranche der USA explodierte dafür nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Fabriken, die davor Waffen produziert hatten, plötzlich über freie Kapazitäten verfügten. Oder: Aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise stammen auffallend viele Gegenstände aus Glas, Metall wurde für die Aufrüstung gebraucht.
Und auch das Wer beeinflusst stets das Wie: Mit den Role Models in der Küche – in den 1950er-Jahren die moderne Hausfrau, dem Gatten und den Kindern ergeben und dennoch sexy, ab den 2000er-Jahren internationale Starköche im Fernsehen, heute etwa vegane Influencer auf Social Media – ändern sich auch die gerade angesagten Utensilien und Gadgets der Essenszubereitung. Oft wird über die Jahrzehnte ihr Image neu definiert. Der Sauerkrauttopf, einst der Notwendigkeit zum Haltbarmachen billigen Krauts für strenge Winter geschuldet und vor allem in bäuerlichen Haushalten zu finden, ist mittlerweile ein anbetungswürdiges Objekt für urbane Fermentierfreaks und in zahlreichen Profiküchen zu langen Reihen angeordnet anzutreffen.
„Die Fetischisierung des Küchendesigns“ begann laut Corinne Mynatt Mitte des 20. Jahrhunderts, als man den Objekten sowohl in Hinblick auf ihre Effizienz als auch auf ein modernes Zuhause als Statussymbol mehr Aufmerksamkeit schenkte. Beeinflusst wurde dieser Aufschwung durch technologische Entwicklungen bei den Geräten selbst, also etwa Kühlschränken und Mixern, weiters durch neue Materialien wie Melamin und andere Kunststoffe, durch neue Massenproduktionstechniken und nicht zuletzt die Senkung der Kosten für Rohstoffe wie Aluminium. „Mitte des 20. Jahrhunderts mussten die Werkzeuge für die Frauen, die den Haushalt beherrschten, nicht nur effizient, sondern auch modisch und fortschrittlich gestaltet sein.“ Ein Beispiel dafür, in Mynatts Buch vorgestellt, ist ein deutscher Gemüsehalter aus Aluminium, der im Jahr 1957 patentiert worden ist und als Vorgänger von Mozzarella- und Paradeiserschneidern gesehen werden kann – und somit verdächtig nach Gadget riecht.
Die Möglichkeit, günstig zu reisen, und die Vernetzung durch das Internet sind ein weiterer Turbo für die Verbreitung und den interkulturellen Austausch von ursprünglich lokal begrenzt eingesetzten Kochwerkzeugen: Wer nach Marokko fliegt, bringt eine Tajine aus dem Souk mit (auch wenn man diese längst online bestellen oder im „Edelhausrat“-Geschäft ums Eck kaufen kann), in Italien wandert ein solider Raviolistempel ins Gepäck, aus Korea reisen golden eloxierte Alutrinkschalen nach Europa, aus Japan natürlich Messer, aber auch winzige Shoyu-Kännchen und Katsuobushi-Reiben, die aus getrocknetem Thunfisch feinste Flocken hobeln, oder auch, der Einfallsreichtum hat gerade auf Reisen nie Urlaub, demnächst womöglich Flocken aus heimischem Fisch – Karpfen-Obushi vielleicht? Apropos Japan: Aus diesem Land stammen auffallend viele der in Corinne Mynatts Buch abgebildeten Objekte und auffallend viele Neuzugänge in westlichen Küchen.
Zum Tools for Food-Fundus gehört etwa eine Sesammühle mit rotem Deckel, die in vielen Ramen-Lokalen zur Standardausrüstung zählt, oder, noch einmal Sesam, ein flacher quaderförmiger Kasten aus Metallgeflecht an einem Holzstiel, mit dem man Sesamkörner, Ginkgonüsse oder Kaffeebohnen über einer Flamme rösten kann. Ebenfalls aus Japan kommen Miniausstecher, die für jahreszeitlich abgestimmte Dekorationen verwendet werden, ein Otoshibuta, ein direkt über dem Gargut zu platzierender Holzdeckel für Töpfe, und ein Shikizaru, ein rund geflochtenes fragiles Bambusgewebe, das vor allem beim Waschen oder Dämpfen von empfindlichen Fischen zum Einsatz kommt.
Die Faszination für fernöstliche Handwerkskunst und exotisch wirkendes Industriedesign geht Hand in Hand mit neuen Anwendungsmöglichkeiten. Ein Beispiel dafür ist eine japanische Eismaschine, die für Kakigori sorgt, feinst gehobelte Flocken von Wassereis; sie taucht in Restaurants rund um den Globus immer öfter auf, vom baskischen Azurmendi über das Potong in Bangkok bis zum Mraz & Sohn in Wien – und zwar im Gastraum, direkt am Tisch. Die Kakigori-Maschine – traditionell kurbelbetrieben, heute oft elektrisch – zeigt damit (stellvertretend für andere Küchenutensilien) zweierlei. Erstens werden, wie eingangs schon angesprochen, die Grenzen zwischen dem Ort sowie den Gerätschaften der Zubereitung und dem Zielort, der Tafel, heute gern überschritten; teilweise wortwörtlich, per pedes – zu dieser Entwicklung gehören nämlich auch servierende Köche. Zweitens zeigt die Kakigori-Maschine, dass in der zeitgenössischen kreativen Spitzenküche so manches Gericht von einem neu entdeckten (und meist ziemlich exotischen) Utensil inspiriert ist. Traditionell ist es doch umgekehrt, das Ding folgt dem Bedarf einer Lebensmittelverarbeitung: Es galt, ein Huhn zu zerlegen, und man entwickelte die Geflügelschere. Nüsse mussten geknackt werden, man kaufte einen Nussknacker, Spaghetti wollten aus dem Kochwasser gehoben werden, es erfolgt der Griff zum Spaghettiheber. Die Kakigori-Maschine hingegen war in westlichen Küchen gleichsam vor dem Bedarf da, das Ding war der Ausgangspunkt der Idee (analog zu dem, was man gern Produktküche nennt). Im Mraz & Sohn etwa hat Lukas Mraz eine aus Tokio selbst importierte japanische Eismaschine im Einsatz („per Post geschickt, im Koffer war kein Platz mehr“). Den Fähigkeiten dieser kulturell fremden Maschine folgend, ersann Mraz Gerichte wie ein „Foie-gras-kigori“ aus gefrorener Gänseleberterrine auf Senfblättern mit Balsamico-Marillenkernöl-Vinaigrette oder, das Thema Wassereis aufgreifend, ein Kakigori aus purem Wassermelonensaft, gewürzt mit süßsauer eingelegter Wassermelonenschale darauf, sowie ein weiteres Kakigori aus Gurke und Molke.
Ebenfalls in die Kategorie „Ding ergibt Gericht“ und „Küchengerät erobert Gastraum“ fallen die Entenpresse, mit der zum Beispiel der flämische Koch Kobe Desramaults schon direkt vor den Gästen geröstete Krustentierköpfe entsaftete, oder der Fleischwolf, der, vielfach kopiert und unzählige Male mit dem Handy gefilmt und gepostet, im Eleven Madison Park in New York Karotten zu Karottentatar verarbeitete.
Ebenfalls die Grenzen zwischen Küche und Esstisch überschreiten jene Kochgefäße, die ob ihres dekorativen Äußeren heute einfach auf dem Tisch platziert werden – was früher in zivilisierten Kreisen undenkbar war, wenn es Gäste zu bewirten galt. Suppen wurden für die Tafel in Terrinen umgefüllt, Fleisch wurde auf Platten angerichtet … Mittlerweile wirkt man, Jamie Oliver, Donna Hay, Yotam Ottolenghi und wie sie alle heißen sei Dank, nicht mehr wie ein Neandertaler, wenn man den Gästen verkrustete Gusseisenbräter zwischen noblem Silberbesteck vor die Nase stellt. Von „hybridem Reiz“ spricht Corinne Mynatt gegenüber A la Carte in diesem Zusammenhang. In Tools for Food zeigt sie frühe Beispiele, wie das stapelbare gläserne Aufbewahrungsgeschirr Kubus des Bauhaus-Gestalters Wilhelm Wagenfeld aus dem Jahr 1938, das explizit nicht nur für den kücheninternen Gebrauch, sondern auch für die Tafel gedacht war. Auch „ikonisches Kochgeschirr“ von Le Creuset, Staub und Serax, für die der niederländische Spitzenkoch Sergio Herman entwirft, falle, so Mynatt, in diese die Grenzen aufhebende Kategorie. Je schöner somit der Topf, desto weniger Koch- und Serviergegenstände braucht man in den eigenen vier Wänden. Privat sei sie Minimalistin, sagt Corinne Mynatt. Und je mehr Objekte, die zum Teil extrem spezifisch sind, sie weltweit zusammentrug, desto mehr wurde ihr bewusst, „dass wir im Grunde nur ganz wenige Dinge zum Kochen brauchen: ein Messer, einen Löffel, ein Schneidbrett, einen Topf.“ —

© Corinne Mynatt



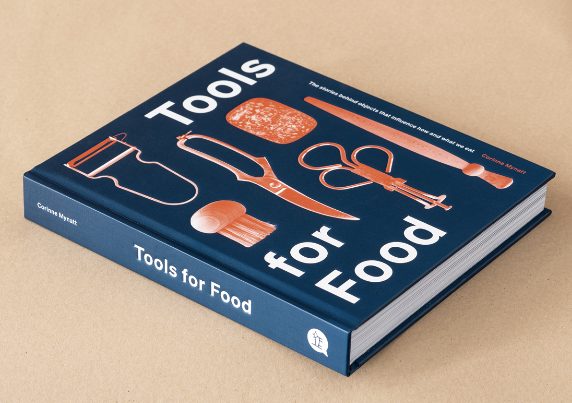
von Corinne Mynatt, Hardie Grant Books Instagram: tools_for_food

