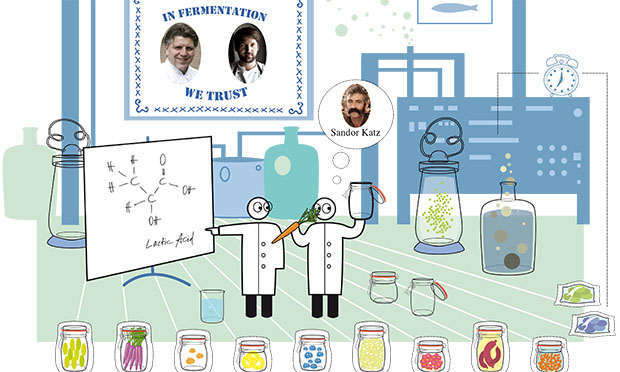Die Zersetzung der Welt
Verrottest du schon oder fermentierst du noch? Der Grat ist schmal und macht die Fermentation zur kreativen Herausforderung. Von explodierenden Feigen, Fenchel-Kimchi oder Rotkrautsturm – und dem Geschmack der Zukunft
Text von Anna Burghardt · Illustration von Andrea Krizmanich
Tausche weiße Kochjacke gegen schwarzen Rollkragenpullover. Selten haben Köche so gedankenvoll von einer Methode geredet, einen solchen philosophischen Überbau erzeugt. Da ist von den Grenzen des menschlichen Einflusses die Rede, von Zutaten, die sich wehren dürfen gegen Bevormundung, von der Koexistenz von Mensch, Pflanzen und Mikroorganismen, von der schöpferischen Spanne zwischen Leben und Zersetzung. Fast könnte man meinen, sie ist die neue Religion der Küche: die Fermentation.
Inspiriert von tendenziell nordeuropäischen Vorreitern wie Magnus Nilsson, Jonnie Boer oder René Redzepi, scheint das Fermentieren auch bei uns das neue Steckenpferd zu sein. Man schafft Gärbottiche an, liest die derzeitige Bibel „The Art of Fermentation“ von Sandor Katz, experimentiert mit violetten Karotten, mit grünen Ringlotten, mit Ananas und Fenchel. Man packt sogenannte Rückstellproben ab, datiert sie akribisch, verkostet sie in bestimmten Abständen, macht Notizen. Noch sind die Ergebnisse auf den Speisekarten hierzulande spärlich, zu vieles ist noch im Versuchsstadium. Aber, so meint etwa Heinz Reitbauer, der sich selbst schon seit ungefähr vier Jahren dem Fermentieren widmet: „Das ist die Zukunft. Der Geschmack ändert sich in diese Richtung.“ Sauerkraut ist längst nicht alles. Noch polarisieren vergorene Lebensmittel, glaubt der Steirereck-Chef. „Aber das Fermentieren wird sich immer stärker durchsetzen.“ Allein wegen der unglaublichen Möglichkeiten zur Variation innerhalb eines Produkts. Eine Karotte, als Beispiel, kann man roh verwenden, auf die verschiedensten Arten gegart – oder fermentiert. Also milchsauer vergoren, wie Reitbauer zumindest seine Verarbeitungsart sprachlich definieren würde. Die so verwandelte Karotte wiederum liefert zusätzlich einen Saft mit neuer Geschmacksdimension. Und gart man die Ergebnisse der Fermentierung, erhält man abermals neue Aromen.
Was genau als Fermentation gilt, ist im Sprachgebrauch unklar. Manchmal werden auch alkoholische Gärung, Reifung oder Oxidation dazugerechnet, die allerdings nicht der ursprünglichen Definition von Fermentation entsprechen: einem anaerobem mikrobiellen Prozess. „Fermentation ist das Leben ohne Luft“, sagte Louis Pasteur. An der Luft gereifter Käse zählt nach dieser Definition also nicht zu fermentierten Produkten, genauso wenig wie schwarzer Tee. Was jedenfalls alles Fermentierte gemein hat: den Prozess des Zersetzens unter Einfluss von Mikroorganismen – eigenen oder zugesetzten. Und, wenn es etwa nach Lebensmittelphilosoph Michael Pollan oder Oberfermentierer Sandor Katz geht: Die Fermentation hat bombastische Auswirkungen auf das menschliche Leben. „Sollte es eine Kultur geben, die nicht auf irgendeine Art Essen und Trinken fermentiert, wurde sie jedenfalls von Anthropologen noch nicht entdeckt“, schreibt etwa Pollan in seinem Buch „Cooked: A Natural History of Transformation“. Und Katz meint, nicht umsonst steckt im Wort Starterkultur „Kultur“. Trauben werden zu bewusstseinsveränderndem Wein, auf dem ganze Religionen entweder ihre Rituale aufbauen oder aber von dem sie sich bewusst abwenden. Mithilfe von Mikroorganismen werden reine Agrarprodukte zu Lebensmitteln, manche sogar zu teuersten Delikatessen: Weizenkörner zu flaumiger Brioche, Trauben zu Bordeaux, Reis zu Sake. Und Mikroorganismen sind es auch, die Rohprodukte haltbar machen und ihnen einen anderen Nährstoffgehalt geben: Milch verdirbt rasch, Parmesan hingegen hält und ist für Intolerante besser verträglich. Krautblätter verfaulen, während sich Sauerkraut, das in Europa vermutlich meistverbreitete fermentierte Produkt, lagern lässt und eine Vitaminbombe ist. Für Sandor Katz bedeutet die jüngste Wiederentdeckung des traditionellen Wissens um die Fermentation auch ein Aufbäumen gegen die Nahrungsmittelindustrie mit ihren leeren, toten Produkten. Ein Statement gegen die grassierende Angst vor Bakterien. Diese sei geradezu absurd, wenn man bedenkt, dass gerade durch die ach so bösen Bakterien jahrhundertelang Lebensmittel haltbar gemacht wurden – Stichwort Sauerkraut, Salzgurken, Salami. Das Fermentieren, meint Katz, spare außerdem Energie, und zwar nicht nur, weil man dafür keine Hitzezufuhr benötige. Sondern auch, weil Gläser voll mit milchsaurem Gemüse, fermentierter Fisch oder Hartkäselaibe zur Not eine Versorgung ohne Kühlschrank ermöglichen.
Krisenszenarien sind für Spitzenköche allerdings nicht der Grund, sich derzeit so emsig dem Fermentieren zu widmen. Sondern eher, weil man damit das Geschmacksspektrum gehörig erweitern oder die Regionalidee noch weiter ausreizen kann. Die Fermentation ermöglicht schließlich gerade bei radikal regionalen Küchenkonzepten eine Art der kreativen Implosion: Während man den Produktradius immer enger zeichnen kann, erweitert man gleichzeitig durch die zusätzliche Verarbeitungsmethode wieder seine Möglichkeiten. „Man kann ein Produkt sehr weit treiben“, sagt Reitbauer. Küchentheoretiker nennen dieses Prinzip gern Deklination: Eine Karotte wird dekliniert, also in die verschiedensten Formen abgewandelt. Bei Heinz Reitbauer ist genau das schon lange Standard: „Ein Produkt in verschiedenen Aromen, das ist unsere Linie. Da ist es auch leichter, eine Harmonie zu finden, als mit sehr vielen verschiedenen Produkten, weil es sich immer irgendwie ergänzt.“ In der Steirereck-Praxis sieht das etwa so aus: Eine frische Gurke, knackig und grün, wird im Saft von fermentierten Gurken eingelegt. „Die Gurke bekommt ja beim Fermentieren farblich ein Problem, eine braune Gurke isst keiner gern. Aber den Saft kann man nehmen.“ Auch für Jonnie Boer aus dem niederländischen Zwolle, der schon lange fermentiert, ist der Saft als Basis vieler Gerichte von großer Bedeutung. Boer setzt auch, anders als viele Köche, Gemüse nicht nur in Salzlake an, um so unter Luftabschluss eine enzymatische Veränderung zu provozieren und durch das Salz die unerwünschten Bakterien abzutöten. Sondern er platziert Radieschen, Karfiol und andere Gemüse in gesalzenem Krautsaft, dem er frische Austern zufügt, um den Zersetzungsprozess zu beschleunigen.
In den meisten Küchen hierzulande geht man indes nach der einfachen Salzlake-Methode vor, die auch Sandor Katz in seiner Anleitung zum Fermentieren ausführlich beschreibt. Und man fermentiert derzeit fast ausschließlich Gemüse (Harald Irka von der Saziani Stub’n ist mit seinen Färöer-inspirierten Fleischversuchen die Ausnahme). Kristijan Bacvanin etwa, Küchenchef der Labstelle am Wiener Lugeck, serviert seine Gemüsekonserven zur Brettljause. Das Fermentieren passt ihm gut ins Konzept – zurück zu den Wurzeln, heißt es schließlich in der Labstelle, aber bitte zeitgemäß. Bacvanin hat zu dieser Art des Haltbarmachens auch einen familiären Bezug: Aufgewachsen im Dreiländereck Kroatien-Ungarn-Serbien, hat er die ersten Erfahrungen schon mit den Großeltern gemacht, die Kraut und Rüben eingelegt haben. „In Holzfässern, die mit einem Tuch zugespannt und dunkel gelagert waren.“ Für ihn ist der Gesundheitsaspekt beim milchsauren Vergären von Gemüse auch wichtig: „Fermentieren ist eine kalte Methode des Haltbarmachens, die wichtigen Inhaltsstoffe werden also nicht durch Einkochen zerstört. Die Milchsäure, die unter Luftabschluss im Gemüse entsteht, ist unter anderem auch gut für den Darm. Und langfristig dämpft sie den Heißhunger auf Süßes. Was jetzt natürlich nicht heißt: Wenn du Gusto auf Malakoff hast, iss Sauerkraut. Aber langfristig eben.“ Gleich nachdem die Labstelle im Herbst 2013 eröffnet hat, haben sich die Köche regelrechte Wettkämpfe im Fermentieren geliefert, erzählt Kristijan Bacvanin, „und jeder Koch hat gerufen, kaufen wir einen Tontopf! Kaufen wir einen Tontopf!“ Er findet aber, dass man mit den üblichen Küchenutensilien auskommt. Bacvanin schneidet verschiedenste Gemüse wie Navetten, Purple-Haze-Karotten, Kürbisse, Schalotten oder Sellerie klein, gibt Gewürze dazu und mischt Maldon Sea Salt darunter. Dann wird alles in einen Gastronormbehälter geschichtet, mit 6-prozentiger Lake aufgegossen und mit einem weiteren, wassergefüllten Behälter niedergepresst. „Das Gemüse muss immer unter Wasser sein.“ Anaerob also, keine Sauerstoffzufuhr – elementar für das Gelingen der Fermentation, wie auch Sandor Katz in seinen Büchern nicht müde wird zu betonen. Bacvanin lässt das Gemisch nur eine Woche bei 18 bis 22 Grad stehen. „Je länger, desto intensiver.“ Sein Gemüse schmeckt zart prickelnd nach Sauerkraut – von dieser Assoziation kommt man generell nicht so leicht weg. Auch mit Feigen vom Wiener Feigenhof hat er schon experimentiert, hat sie nach dem Fermentieren in Lake in Öl eingelegt. „Das ist aber in die Hose gegangen. Ich dachte, die Schale wird hart und das Innere entwickelt sich gut, aber nix da. Der Chef ist gekommen und hat nur gesagt, du, dein Feigenglas ist explodiert.“
Misserfolge sind Teil des Herumprobierens, diese Erfahrung hat auch Philipp Vogel vom Edvard im Wiener Kempinski machen müssen. Der Deutsche hat vor ein paar Monaten begonnen, Rotkraut, rote Rüben und andere Gemüsesorten zu vergären. „Das Sauerkraut ist nichts geworden, das werden wir noch einmal versuchen.“ Ähnlich wie Reitbauer forciert auch Vogel Gerichte mit wenigen Produkten in verschiedenen Zuständen. „Fermentieren, das ist eine neue Dimension im Geschmack.“ Das Schöne daran ist für ihn, ähnlich wie beim Wein: „Die Mikroorganismen setzen einem Grenzen beim Beeinflussen. Das Produkt kann sich noch wehren.“ Apropos Grenzen: Diese sind in diesem Zusammenhang ein immer wiederkehrendes Thema. Was noch als fermentiert gilt und was schon als verrottet, ist, meint Sandor Katz, einerseits kulturell bedingt: Manche Kimchi-Arten, mit Fischextrakten versetzt, sind für westliche Menschen ungenießbar, da von höllisch strengem Geschmack; Roquefort wiederum vermag Asiaten in die Flucht zu schlagen. Die Grenzen sind aber auch persönlich bedingt. „Zwischen noch gut und schon hinüber ist eine Spanne, in der wir kreativ sein können.“ Kempinski-Küchenchef Philipp Vogel, der Jahre in China gearbeitet hat, hat dort gesehen, in welche Dimensionen das Fermentieren gehen kann, hat Dinge gekostet, die seine Toleranz bei weitem überstiegen. „Sticky Tofu hat so extrem verdorben geschmeckt, den würde das Wiener Marktamt nicht zulassen.“ Philipp Vogel hat vor, fermentiertes Gemüse vermehrt bei seinen Desserts einzusetzen. „Gerade da, wo eine andere Zutat viel Zucker liefert, kann man damit spielen.“ Für ihn birgt der Trend zum Fermentieren bei aller Lust am Spielen allerdings eine Gefahr: „Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr für uns selbst und die Kollegen und Journalisten kochen. Man wird sehen, ob es sich durchsetzt. Es ist ja ein bisschen wie beim Dry-aged-Beef: ein schmaler Grat zum Verdorbenen, aber bei uns hat es sich bewährt.“
Diesen Grat hat Harald Irka, der junge Shootingstar in der Saziani Stub’n, auf Reisen nach Nordeuropa kennen gelernt. „Auf den Färöer-Inseln liebt man den Geschmack von nahezu verdorbenem Schaffleisch. Man fermentiert Lammfett, Lammmägen, aber auch Kabeljau und Wal.“ Leif Sörensen, der wohl beste Koch der Färöer-Inseln, sei ein Spezialist auf diesem Gebiet und habe Irka auf den Geschmack gebracht. „Für den Durchschnittseuropäer ist das allerdings eher gewöhnungsbedürftig bis ungenießbar, aber wir arbeiten gerade am Entschärfen.“ Die Fermentation von Fleisch umfasse ja ein unglaublich breites Spektrum, erzählt Harald Irka. „Nach einer thailändischen Rezeptur haben wir letztes Jahr zum ersten Mal eine fermentierte Wurst hergestellt, Naem Moo genannt. Traditionell macht man sie mit Schwein. Wir haben jedoch Lamm verwendet.“ Das Fleisch wird faschiert, mit Salz, Knoblauch und anderen Gewürzen versetzt und dann bei 30 °C für fünf Tage fermentiert. „Das Resultat ist eine intensive Lammwurst, die im Original über Holzkohle gegrillt wird.“ Neben Fleisch wurde bei Harald Irka schon so ziemlich alles fermentiert. Knoblauch etwa, „nach japanischem Vorbild“, oder Rotkraut – mit Starterkultur – für einen „Sturm“. Manchmal rechtfertigt aber das Ergebnis den großen Aufwand nicht, und manchmal macht ihm seine jugendliche Unruhe einen Strich durch die Rechnung. Nicht allein ein hervorragendes Ausgangsprodukt, gepaart mit der richtigen Temperatur, sondern auch die Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Fermentation, meint Irka. „Leider bin ich oft zu ungeduldig, um ein optimales Ergebnis abzuwarten.“
Dass das Fermentieren als Methode zum Haltbarmachen vor allem in nördlichen, kargen Gebieten wie auf den Färöer-Inseln praktiziert wird, scheint zwar naheliegend, ist aber ein Trugschluss. Nicht nur da, wo im Großteil des Jahres nichts gedeiht, heißt es, das günstige Zeitfenster zu nützen. Sondern auch in Gegenden, wo zwar aufgrund des Klimas rund ums Jahr viel wächst, aber eben wegen der Hitze auch schnell verrottet. „Im Süden muss man die Transformation rasch in die richtigen Bahnen lenken“, schreibt Sandor Katz und spielt wieder auf die Spanne zwischen genießbar und verdorben an. Im Sudan etwa hat er achtzig verschiedene Fermentprodukte gefunden.
Das Fermentieren als ursprünglich rurale Konservierungsart hat längst die urbanen Zentren erreicht. Künstler und Designer nehmen sich des Themas an – Keramiker gestalten schicke Sauerkrauttöpfe, und es gibt Kunstprojekte wie die Wiener Performance „Phora“, bei der Fermente aus Selbstgesammeltem vaporisiert und den Besuchern über die Luft zugänglich gemacht werden. Nachdem Selbsterntefelder und Gemeinschaftsgärten in Metropolen wie Berlin oder New York boomen, gilt es den Überschuss an Gemüse zu verarbeiten – das Fermentieren liegt nahe. Dieses Überschwappen vom Land auf die Stadt ist in Katz’ Augen eine nur scheinbar jüngere Entwicklung. „Aber in Wirklichkeit sind landwirtschaftliche Veränderungen doch immer von den Städten ausgegangen. Neue Getreidesorten wurden früher von Stadt zu Stadt gehandelt. Die Städte kreierten Nachfrage – Stichwort Bauernmärkte oder trendige alte Gemüsesorten. Und die Agrarforschung findet in Städten statt.“
Eine alte rurale Methode an einem überaus urbanen Standort – dieser reizvolle Kontrast ist für Gastronom Brian Patton ausschlaggebend, sich in Zukunft verstärkt der Fermentation zu widmen. Vielleicht war auch ein bisschen der ansteckende Enthusiasmus von Fermentations-Guru Sandor Katz schuld, den der Chef des Wiener Pubs Charlie P’s im Vorjahr bei einem Workshop kennen gelernt hat. Patton plant im Sommer dieses Jahres wieder eine temporäre Dependance neben dem Badeschiff am Donaukanal, Big Smoke genannt – es geht um Barbecue, ergo viel Fleisch. Und solches, hat Patton auf seiner Recherchereise nach Texas erfahren, braucht Ausgleich, wenn es die Gäste nicht erschlagen soll. Ausgleich in Form von knackigem, milchsauer vergorenem Gemüse. Christian Petz fungiert als Berater, explizit gefragt ist dessen Input in Sachen Fine Dining. „Das Fermentieren war ja“, meint Patton, „in den letzten Jahren eher in der internationalen Topgastronomie zuhause, also wahrscheinlich etwas für ein bisschen älteres, zahlungskräftiges Publikum.“ Er möchte diese „edgy“ Methode nun einer jüngeren, kulinarisch unbedarfteren Zielgruppe näherbringen, 21 bis 38 Jahre alt, und sie so demokratisieren. Fermentiert werden sollen im Big Smoke aber nicht nur Gemüsesorten – zu einer anderen Art Coleslaw etwa oder zu Fenchel-Kimchi –, sondern auch Würstel. Wie Harald Irka hat Brian Patton hier die thailändischen Naem Moo vor Augen. Und Charlie-P’s-Küchenchef Petr Matusny lernte in Dublin von einem koreanischen Mitbewohner alles über Kimchi – oder, besser gesagt, einiges, denn Kimchi ist ein endloses Thema.
Endlos warten will Heinz Reitbauer indes zwar nicht, aber Geduld ist beim Fermentieren eine Zutat, die nicht zu unterschätzen ist. Abwarten und immer wieder kosten ist seine Devise. Von einem fermentierten Produkt, mit dem er vor einem Jahr begonnen hat (und das er noch nicht nennen will), hat er zwölf Rückstellproben in kleinen Einheiten abgepackt, beschriftet und sich dann in den Kalender eingetragen, dass er alle zwei Wochen verkosten muss. Ein Mordsaufwand für eine einzige Zutat. Aber mit einer wichtigen Erkenntnis: „Die Fermentation ist eigentlich nach zwei bis vier Wochen abgeschlossen, ab dann wird nur mehr gelagert. In den letzten paar Monaten hat sich das Produkt aber sensationell entwickelt. Hat Säure abgebaut, ist homogener geworden, runder, vielschichtiger. Und selbst nach acht Monaten ist es super, der Saft genauso wie das Produkt selbst. Wir haben also gesehen, dass es Zeit braucht.“ Das sei wirklich faszinierend, dass sich Zutaten im Gegensatz zum Einlegen in Essig oder Alkohol noch entwickeln. Für heuer plant er, davon richtig große Mengen zu machen, „um in der Zeit, in der es karg ist, ein Produkt zu haben, das richtig pfeift“. Heinz Reitbauer spricht damit einen wichtigen Aspekt an: Es ist dann Saison, wenn eben nicht Saison ist. Man fermentiert ein Gemüse dann, wenn es wächst (ob reif verarbeitet oder gerade nicht, macht etwa bei Paradeisern einen großen Unterschied), um es dann als knackiges Produkt aus dem Ärmel zu zaubern, wenn die Gäste es ganz und gar nicht erwarten. Die Fermentation birgt also ein großes Überraschungspotenzial, umso mehr, als Gemüse prinzipiell bei korrekter Verarbeitung auch nach Monaten noch richtig Biss hat.
Heinz Reitbauer fermentiert aber nicht nur Gemüse. Auch Umeboshi, die japanischen Salzpflaumen, hat er schon österreichisiert. „Stockharte, grüne, unreife Ringlotten. Die lassen wir in Salzlake eine gute Woche liegen, vakuumieren sie flach und legen sie auf der Terrasse in die Sonne. Dort sollen sie weich werden und fermentieren.“ Die Umeboshi sind Teil eines Reitbauer’schen Zukunftsprojekts: „Wir haben vor Jahren einmal gesagt, wir wollen im Kopf einmal österreichische Würzsaucen definieren. Das würde der österreichischen Küche ein bisschen mehr Geschmacksspektrum geben.“ Die fermentierten Ringlotten etwa, vom Kern gelöst und passiert, fungieren dergestalt als neue österreichische Würzsauce mit exotischem Aroma. Und lassen erahnen, was alles möglich ist, wenn man heimische Zutaten und asiatische Fermentationstechniken kombiniert: von 1.000-jährigen Sulmtaler Eiern bis zu steirischem Miso aus der Käferbohne …