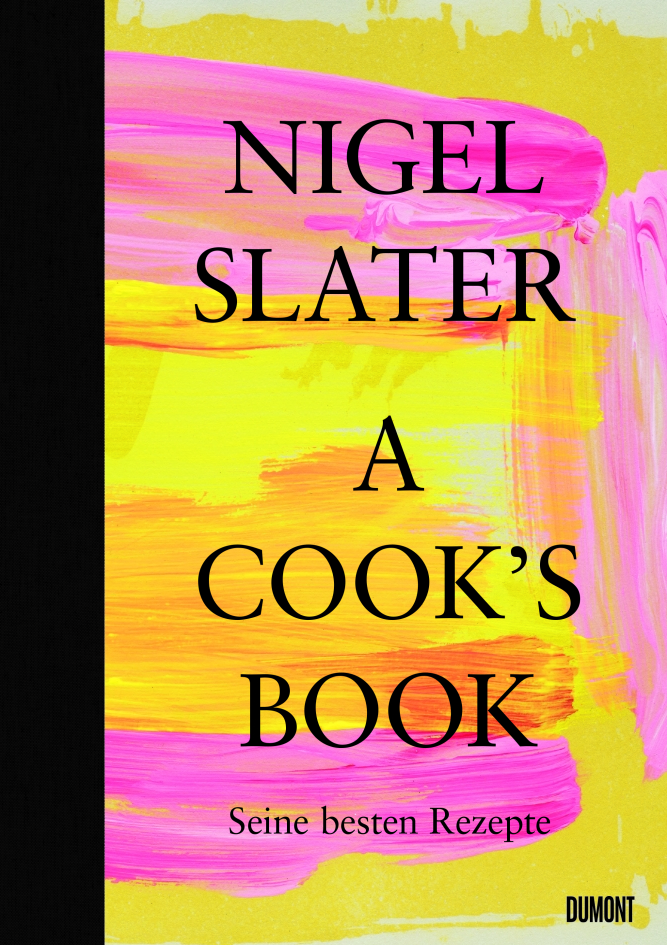Das Rendezvous
Ein Spaziergang durch den Norden Londons, der an der Tür eines der Größten endet – und von Neuem beginnt.
Manchmal gehe ich alleine essen, zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin. Es hat Vorteile, alleine zu essen. Ich widme den Dahlien, die in einer kleinen Vase auf dem Tisch stehen, mehr Aufmerksamkeit, kontrolliere die gewichtige Weinkarte nicht von vorne bis hinten, weil ich weiß, dass ich für mich allein keine ganze Flasche Wein bestellen werde, und gestehe mir fantasielose Bestellungen zu, weil ich niemandem beweisen muss, was für ein fachkundiger Gast ich bin.
Wenn das Essen dann serviert wird, gehört dem Teller meine ganze Konzentration. Ich betrachte die Schönheit der angerichteten Speisen, freue mich daran, wie ihre Farben zufällig zueinanderpassen und ineinander übergehen, verharre länger als sonst mit der Nase über dem Teller und versuche, schon vor dem ersten Bissen ein paar Nuancen zu erkennen, die dem Gericht in der Küche mit auf den Weg gegeben wurden.
Allerdings hat das Alleinessen auch einige Nachteile. Ganz am Anfang steht die Tatsache, dass viele Restaurants allein essende Gäste nicht schätzen.
Das hat nachvollziehbare Gründe. Tische sind Betriebsflächen, an denen Geld verdient wird. Je mehr Menschen an einem Tisch sitzen, desto mehr Umsatz (und wenn jemand dabei ist, der die Weinkarte gut lesen kann, umso mehr Umsatz). Allein speisende Gäste haben also das Stigma, den Umsatz eher zu schmälern als ihn zu steigern, ganz egal, wie großzügig sie bestellen. Deshalb bekommen sie zur Sicherheit den kleinsten, unmöglichsten Tisch zugewiesen, müssen neben der Klotür sitzen oder unter den Mantelwucherungen anderer Gäste. Sie sind, obwohl sie entschlossen sind, Geld auszugeben, Umsatzminimierer. Wenn ich mich für ein Essen allein angemeldet habe, treffen mich folgerichtig beim Einchecken die prüfenden Blicke des oder der Maître d’: Hast du keine Freunde? Will niemand mit dir essen gehen? Du schaust doch eigentlich ganz nett aus, was ist los mit dir, Alter?
Diese Vorwürfe stehen im Raum, und ich weiß das. Deshalb bestelle ich, auch wenn ich schon weiß, dass ich allein essen werde, meistens einen Tisch für zwei. Zwar sind die Blicke der Kellnerinnen und Kellner, denen ich sage, dass meine Verabredung leider doch nicht auftauchen wird, auch nicht ohne. Aber sie enthalten wenigstens einen Anflug von Mitleid – oje, dafür kriegst du wenigstens etwas Anständiges zu essen.
So kam ich zuletzt zu zwei schönen Abenden in London. Einmal speiste ich im St. John ein unglaublich feines Linsen-Lauch-Gemüse, dem eine geheimnisvolle Schärfe innewohnte, der ich erst auf den Grund kommen muss. Das Essen war so gut, dass ich mich über den unakzeptablen Platz, der mir – ich hatte, dumm genug, für eine Person bestellt – in der letzten Ecke zugewiesen worden war, nicht eine Sekunde lang ärgerte.
Am nächsten Abend besuchte ich Trullo, einen schicken Italiener in Highbury, eigentlich das kulinarische Kompetenzzentrum in Nordlondon, mit zarten Freundschaftsbanden zu den Fergusons und zur großartigen Guardian-Kolumnistin Rachel Roddy. Dort saß ich besser, weil, mmh, mein Date nicht auftauchte. Außerdem bekam ich zur Vorspeise einen Salat, der mir so gut schmeckte, dass ich ihn zu Hause sofort nachbauen musste, um ihn mit euch teilen zu können.
Es war ein Salat aus drei Komponenten: reifen Feigen, Rucola und einem milden Pecorino. Nun gibt es verschiedene Sorten Rucola-Salate, ich meine die größeren, milderen Salatblätter, nicht die messerscharfen Blätter, die im Supermarkt abgepackt in Säckchen verkauft werden – die sind nämlich für diesen Salat zu grobianisch, ich ersetze sie durch einen Castelfranco, dessen feine Bitternoten diesen Salat noch einmal interessanter machen.
Pro Teller braucht es – je nach Größe – zwei bis vier Feigen (idealerweise tischtennisballgroß). Große Feigen viertle, kleine halbiere ich, dann gebe ich ein paar Flocken Salz auf die Schnittfläche und jeweils einen Tropfen Olivenöl. Die Salatblätter schneide ich in schmale Streifen und lege sie über die Feigen. Aus dem Fruchtfleisch einer Feige (etwa 1 TL), 1 TL Honig, 1 TL Senf, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 2 EL neutralem Öl und 1 EL Olivenöl rühre ich eine Vinaigrette an und gebe sie über den Salat. Dann reibe ich den Pecorino auf der Grobreibe in Späne und gebe jedem Teller noch eine Drehung aus der Pfeffermühle mit auf den Weg.
Ihr wollt jetzt sicher wissen, welches Date nicht aufgetaucht ist, und ich kann es euch sagen. Es war ein Mann, den ich überaus verehre, und zwar seit langer, langer Zeit. Er ist im Norden Londons zu Hause, weshalb ich mir in unmittelbarer Nähe des Arsenal-Stadions ein Airbnb besorgt hatte, das vollgestopft mit interessanten Büchern ist, ein seltenes Glück. Das Date tauchte nicht auf, weil ich schon den ganzen Nachmittag bei ihm verbracht hatte, und bevor ich den Namen nenne, möchte ich die Laudatio auf diesen besonderen Menschen singen: Er ist für mich mehr als eine kulinarische Autorität. Ein Vertrauter. Wie jeder Autor, jede Autorin, deren Bücher ich regelmäßig lese, ist er mir auf eine ganz spezifische Weise ans Herz gewachsen. Ich habe mich im Klang seiner Worte eingenistet und folge seinen Ideen voller Vertrauen.
Am Anfang hielt ich ihn vor allem für einen guten Lieferanten von Rezepten, einen wie – um ein besonders unpassendes Beispiel zu nennen – Jamie Oliver, der jedes Jahr ein Kochbuch auf den Markt bringt, wenn auch mit etwas lyrischeren Titeln als „30 Minutes Meals“. Als ich seine ersten Kochbücher, speziell das handliche Eat. The Little Book of Fast Food in Verwendung nahm, war mir noch nicht bewusst, über welche speziellen Talente dieser Mann verfügt – und damit meine ich nicht nur seine kulinarischen, sondern auch die literarischen, ich würde fast sagen philosophischen Fähigkeiten. Das änderte sich mit dem Erscheinen von Tender.
„ten-der ’tender : so zart, dass die Zähne leicht hindurchdringen: der Zustand, in dem etwas zum Essen bereit ist: die Blätter eines Bundes Spinat, eine reife Feige. Von weicher oder mürber Konsistenz. Nicht hart oder zäh. Reif. Empfindlich, heikel. Liebevoll. Zartfühlend. Mitgefühl, Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen und Gefühl zeigend …“
So steht es auf dem Umschlag des ersten Bands aus dem Jahr 2012, in dem der Autor erzählt, wie das Gemüse in seinem Garten austreibt, wächst und reif wird und was er damit tut, wenn es so weit ist. Das könnte auch in einem Bauernkalender stehen, ich weiß, aber hört dem Mann erst einmal zu, wenn er sein Gemüse genau anschaut: „Die Schönheit eines einzigen Salats, seine inneren Blätter fest und knackig, die äußeren geöffnet wie die Blüten einer Bauerngartenrose; das glühende Safrangelb eines frisch geöffneten Kürbis; die gelockten Triebe einer Erbsenpflanze …“
Oder, anderes Beispiel, diese Etüde auf den Grünkohl: „Aus der Ferne, sehr große wellenförmige Kissen in Grün- und düsteren Blautönen. Aus der Nähe, raue, gefiederte Blätter mit einem kräftigen Hauptstiel. Im Mund von kräftiger Konsistenz, bissfest, süßlich und leicht bitter. Grünkohl ist von angenehmer Bescheidenheit und hat zugleich einen lebhaften Geschmack …“
Ich nenne den Namen also erst jetzt, wo ihr ihn längst erraten habt. Mein Gesprächspartner ist Nigel Slater, und ich streiche schon ein paar Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt vor seinem Haus herum, weil ich es hasse, unpünktlich zu sein. Da ich aber aus eigener Erfahrung weiß, dass schlimmer als unpünktliche Gäste nur die sind, die zu früh kommen, warte ich im Londoner Sprühregen, bis die Stunde schlägt.
„Nigel.“ Slater öffnet die Tür wenige Sekunden, nachdem ich geläutet habe, und streckt mir die Hand entgegen. Er strahlt eine heitere Gelassenheit aus, nimmt mir die Jacke ab und bittet mich einen Stock tiefer, in den Raum, wo der Ruhm dieses Mannes zu Hause ist: in die Küche.
Das Haus, in dem Nigel Slater lebt, ist ein geräumiges, vierstöckiges Townhouse aus graubraunen Backsteinen. Nach hinten hinaus erstreckt sich, von der Straße aus unsichtbar, ein langer schmaler Garten, in dem sechs Gemüsebeete angelegt sind, jeweils von Buchshecken umgeben.
Slater kaufte sein Haus gerade noch rechtzeitig, bevor die Immobilienpreise in London vollends durch die Decke gingen. Er hat sich darin nicht eine, sondern zwei Küchen eingerichtet. In der ersten, die das gesamte Untergeschoß umfängt, kocht und schreibt Slater. Er musste dafür eine ehemalige Einliegerwohnung „in einem langen, langen Jahr“ wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuführen, denn hier hatte sich – „ein Aha-Moment erster Güte“ – die ursprüngliche Küche des Hauses samt ihren Vorratsräumen befunden. Der hell gestrichene Raum, dessen Umbau ihn „jeden Penny meiner Ersparnisse“ kostete, ist in sanftes, indirektes Licht getaucht. Auf dem riesigen Küchenblock herrscht penible Ordnung. In einem versenkten Regal stehen unzählige handgemachte helle Keramikbecher, die Slater, Freund der Kunst, mit der ihm eigenen Akribie sammelt.
In der kleineren, zweiten Küche im Obergeschoß empfängt Slater in der Regel Gäste, hier entstehen auch die meisten Fotos für seine wöchentliche Kolumne. Diese Arbeit prägt seinen Alltag seit mehr als drei Jahrzehnten. Slater zeigt sich höchst dankbar dafür, dass ihm der Observer, die Sonntagsausgabe des Guardian, nach wie vor den Platz einräumt, zu tun, was er am liebsten tut: zu kochen und darüber zu schreiben. „Es scheint mir immer noch unwirklich“, sagt er und erzählt, vielleicht eine Spur kokett, dass er immer noch zusammenzuckt, wenn ihn seine Redakteurin anruft. „Ich halte nie etwas für selbstverständlich“, sagt er. „Auch nach dreißig Jahren nicht.“
Ich bin „for tea“ eingeladen und darf aus einem reichen Angebot an Teesorten spektakulär schöne Grünteeblätter, die mit Osmanthusblüten aromatisiert sind, auswählen. Außerdem hat Nigel gebacken, einen Haselnuss-Schokolade-Kuchen und mehrere Sorten von Keksen, die ich bewundern darf, während er auf umständliche Weise den Tee zubereitet, das Wasser in einer eigenen Kanne abkühlen lässt, dabei ständig das elegante kleine Thermometer kontrolliert, das wie sämtliche andere Gebrauchsgegenstände in dieser Küche von ausgesuchter Schönheit ist.
„Ein Keks?“, fragt mich Nigel. Ich nicke, zurückhaltender, als ich eigentlich bin, und nehme von jeder Sorte nur eines. Nigel zwei. „Als Kind“, sagt er, „habe ich mich ausschließlich von Süßigkeiten ernährt.“ Die Geschichte dieser Kindheit ist in England inzwischen Schulbuchliteratur. Das kam so: Eines Tages rief – Alarm! – die Redakteurin des Observer an, nicht um Nigel Slater, wie dieser befürchtete, die Mitarbeit aufzukündigen, sondern um ihn zu bitten, doch über die Geschmäcker seiner Kindheit zu schreiben.
Das tat Slater gern. Allerdings ließ er sich dazu hinreißen, persönlicher zu werden als sonst, wenn Lebensmittel und ihre Verwandlungen die Hauptrollen in seinen Geschichten übernehmen. Er war unsicher, als er den Text abschickte, und er sah sich in seinen Zweifeln bestätigt, als bald darauf wieder sein Telefon klingelte. Aber die Redakteurin hatte an der Geschichte nichts auszusetzen, im Gegenteil, sie war begeistert. Sie fragte Slater, ob er nicht etwas Längeres daraus machen könne, ein Buch zum Beispiel.
Das Buch bekam den Titel Toast. The Story of a Boy’s Hunger (die deutsche Übersetzung packte in den Untertitel Slaters späteren Ruhm als Kochbuchautor hinein und drehte ihn ins Harmlose: „Wie ich meine Leidenschaft für das Kochen entdeckte“). Dabei ist die Geschichte, auch wenn es dauernd irgendwie ums Essen geht, von berührender Tragik, voll kindlicher Verzweiflung und unbestimmter Sehnsucht, Einsamkeit und sexueller Verwirrung. Slater erzählt von seiner Mutter, die, weil sie nicht kochen konnte, immer nur Toast servierte. Er erinnert sich, wie es zu Hause zu Weihnachten roch, nach warmen süßen Früchten, nach einem Kuchen im Ofen, einem heißen Bügeleisen, einem Golden Retriever, der sich beim Herd zusammenrollte, dem 4711-Parfüm seiner Mutter – und nach dem Urin seiner Tante Fanny, die im hohen Alter verlässlich in die Hosen machte.
Er erzählt von seinem Vater, der ihn nach dem plötzlichen Tod der Mutter mit Süßigkeiten fütterte, weil es ihm nicht gelang, etwas Besseres auf den Tisch zu stellen – „ich habe ihm einige Zahnarztrechnungen zu verdanken.“ Aber er spart auch dessen Wutausbrüche nicht aus, weil der Bub keine Eier mochte und das Rührei hinunterwürgen musste, bis er kotzte (Eier isst Slater bis heute keine und Milch mag er auch nicht, außer sie ist eiskalt). Er erzählt, wie sein Vater jedes Mal, wenn er ihm etwas zu essen gab, deprimiert zuschaute, wie es dem spindeldürren Sohn schon wieder nicht schmeckte, wie er in seinem Essen herumstocherte und es auf dem Teller hin und her schob: „Die Enttäuschung meines Vaters über seinen jüngsten Sohn ist so offensichtlich, dass man sie auf einen Teller packen und essen könnte.“
Zuerst tröstete den Buben der Geschmack von Süßigkeiten, etwa der Marshmallow, den ihm sein Vater neben das Bett legte und der den Gute-Nacht-Kuss ersetzen musste, den ihm seine Mutter nicht mehr geben konnte. Dann aber begann er zu ahnen, dass Essen anders, besser, großartig schmecken kann, und diese Ahnung erfüllte ihn mit dem Wunsch, diesen Geschmack selbst herzustellen: jene Tätigkeit auszuüben, die ihm wegen der Gefahr heißer Herdplatten oder siedenden Wassers von den Eltern verboten worden war, die er aber als fehlendes Verbindungsteil zwischen seiner Sehnsucht und ihrer Erfüllung identifizierte. Er wollte kochen, er lernte kochen, und er kocht noch immer.
Toast wurde ein riesiger Erfolg. „Viele Menschen schrieben mir, sie hätten in meiner Kindheit ihre eigene wiedererlebt.“ Das Buch wurde verfilmt, kam als Schauspiel auf die Bühne, wurde für den Schulunterricht kanonisiert.
„Ich bezeichnete mich viele Jahre lang als Koch, der schreibt“, sagt Slater, als wir am Küchentisch sitzen, den Haselnuss-Schokolade-Kuchen kosten, der, wie erwartet, köstlich ist, und darauf warten, dass das Wasser für den Grünen Tee endlich auf die erforderlichen sechzig Grad abgekühlt ist. „Ich wollte immer Koch in einem Restaurant werden – bis ich es war und merkte, dass eine Restaurantküche nichts für mich ist. Ich hasste den Lärm. Ich hasste es, im Team zu arbeiten. Alles, was ich wollte, war, Menschen etwas Gutes zu essen zu machen und dabei ungestört zu sein.“
Nach den gescheiterten Versuchen in Restaurantküchen heuerte er in einem kleinen Londoner Café an, wo er allein für die Küche zuständig war, kochen, servieren und ohne Stress „gute, einfache“ Speisen zubereiten durfte. Im Café lernte er eine Kundin kennen, die ein Food-Magazin namens – Achtung! – Alacarte herausbringen wollte. Sie fragte den jungen Mann in der Küche, ob er nicht die Rezepte kontrollieren könnte, die im Heft erscheinen sollten. Das übernahm Nigel gern. Er bereitete die Gerichte gemäß Anleitung so sorgfältig und hübsch zu, dass ihn die Herausgeberin fragte, ob er nicht eine eigene Rezeptkolumne übernehmen wolle.
Nigel war im Glück, ohne zu wissen, dass ihm die Kolumne das Tor zu einem neuen Beruf öffnen würde. Es dauerte nicht lang, bis jemand beim Magazin Marie Claire den unbekannten Alacarte-Kolumnisten entdeckte und ihn in eine deutlich auflagenstärkere Umgebung lotste. Fünf Jahre lang kochte und schrieb Nigel Slater für die Marie Claire, bis ihn schließlich der Anruf des Observer erreichte, vor ziemlich genau dreißig Jahren. Seit damals kocht Nigel Slater Woche für Woche drei bis fünf Rezepte, die jeweils am Sonntag erscheinen.
Er kocht jedes Gericht selbst, erledigt den Einkauf, die Vorbereitungen, richtet die Teller an und macht den Abwasch. Er hat keine Assistenz außer einem professionellen Tester, der jedes Rezept nachkocht und überprüft, bevor es ins Blatt oder in ein Buch gerückt wird. Der Fotograf ist seit 35 Jahren Jonathan Lovekin, dessen sensible, fast überempfindliche Landschafts- und Reportagefotografie Slater so bewunderte, dass er Jonathan fragte, ob er nicht auch Food fotografieren könne. Seither arbeiten die beiden ohne Unterbrechung zusammen.
Wir sprechen über Wahrheit und Melancholie. Melancholie ist ein Motiv, das mir stets in den Sinn kommt, wenn ich Slaters Texte lese, egal, ob er Impressionen aus seinem Garten aufschreibt oder über das Abwägen von Möglichkeiten, das dem Aufschreiben eines Rezepts vorangeht.
Vielleicht entspringt dieser melancholische Grundton der konzentrierten Ruhe in diesem Raum, sagt er, wo drüben auf dem Herd etwas entsteht, schmurgelnd und duftend, während er selbst an dem Tisch, an dem wir gerade sitzen, Notizen in eines der unzähligen Notizbücher kritzelt, mit den großen runden Buchstaben, die so unglaublich viel Platz brauchen, dass Nigel schon über tausend Kladden vollgeschrieben hat.
Das mit der Wahrheit ist eine andere Geschichte. „Wahrheit“, sagt er, „bedeutet für mich, die wahre Geschichte eines Rezepts zu erzählen.“ Diese Geschichte beginnt in der Regel beim Einkauf. In den Geschäften rund um sein Haus begegnet er seinen nächsten Geschichten fast automatisch. „Ich sehe die ersten Kastanien und habe eine Idee. Oder ich stoße auf dieselbe Apfelsorte, die meine Eltern im Garten angebaut haben, und weiß, was ich erzählen will. Wenn ich mit diesen Dingen in der Tasche auf dem Weg nach Hause bin, fühle ich mich wahrhaftig und aufrichtig – honest and true.“
Slaters Küche ist weniger von genuiner Kreativität geprägt als von permanenten Weiterentwicklungen und Verbesserungen klassischer Rezepte. In seinem Küchentagebuch formuliert er sein kulinarisches Programm so: „In der Küche bin ich weder schludrig noch besonders pedantisch (ich habe nichts für verklemmte Feinschmecker übrig; sie machen den Eindruck, als hätten sie wenig Spaß). Ebenso wenig bin ich jemand, der versucht vorzuschreiben, wie man etwas machen sollte, und ich bin am glücklichsten, wenn Leser mein Rezept einfach als Inspiration für ihr eigenes nutzen. Wenn wir ein Rezept Wort für Wort befolgen, lernen wir nicht wirklich, wir haben nur am Schluss ein fertiges Essen.“
So sympathisch mir diese Art zu kochen ist, sie hat auch Gegner. Zum Beispiel schrieb ein deklarierter „Pedant in der Küche“ namens Julian Barnes eine leider ziemlich brillante Dekonstruktion von Slaters Schweinskoteletts mit Chicorée aus Real Food. Der hochdekorierte Schriftsteller Barnes, der sich in Rezepten Grammangaben für die Menge gehackter Zwiebeln und genaue Durchmesser der zu verwendenden Pfannen wünscht, erblickte in Slaters „freundlicher Art, die in Zeiten von Stress leicht irritierend wirken kann“, falsche Versprechungen und argumentierte das gekonnt durch.
Als ich Nigel auf Barnes’ Pedanterie anspreche, stöhnt er laut auf. „Eigentlich“, sagt er, „müsste ich geschmeichelt sein, in einem Text dieses unglaublichen Autors vorzukommen“, und zählt kundig die literarischen Verdienste von Barnes auf, die Leichtigkeit seiner Sprache, das Kunstverständnis, den Witz.
„Aber ich war tief getroffen.“
Sowohl Slater als auch Barnes sind Sammler des südafrikanischen Künstlers William Kentridge. „Ich begann sehr früh, Bilder von William zu sammeln, als man sich das noch leisten konnte“, sagt Slater. Bei einem Atelierbesuch vor einer Verkaufsausstellung betrachtete er eines der Werke des inzwischen weltberühmten Kentridge, als er plötzlich spürte, dass jemand direkt hinter ihm stand. Slater drehte sich um. Barnes schlug die Augen nieder und hauchte: „Ist mir vergeben?“ Natürlich, sagte Nigel, bezaubert vom Charme des Schriftstellers.
„Aber innerlich dachte ich mir: Eigentlich nicht!“ Erst, als Slater Jahre später ein Bild von Kentridge kaufen konnte, von dem der wusste, dass auch Julian Barnes es für sein Leben gern besessen hätte, dachte er: „Jetzt sind wir quitt.“
Nun ist Kritik nicht die Regel, sondern die Ausnahme unter den Reaktionen, die Nigel Slater erfährt. Wenn am Sonntag gegen halb elf seine Kolumne online gestellt wird, ergießt sich regelmäßig ein Strom an Zustimmung durch seine Social-Media-Kanäle, der ihn „den ganzen Sonntag lang beschäftigt“. Slater ist der Meinung, dass die fünf Minuten, die sich jemand nimmt, um ihm zu schreiben, mindestens ein persönliches Dankeschön wert sind, und erledigt auch diese kontinuierlich anschwellende Arbeit – die Zahl seiner Instagram-Follower nähert sich der halben Million – persönlich.
Vielleicht besteht das Erfolgsrezept Slaters ja darin, stets die Zeit vor Augen zu haben, die jemand mit seiner Arbeit verbringt. „Es ist ein totaler Horror für mich, dass Menschen ihre Lebenszeit darauf verwenden, ein
Rezept von mir zu kochen – und es klappt nicht. Immer wenn mich auf der Straße jemand anspricht und sagt: Ich habe deinen Schokoladekuchen gebacken, zucke ich innerlich zusammen und bereite mich darauf vor, mich in den Staub werfen zu müssen. Es ist meine größte Angst, Menschen ihre Zeit geraubt zu haben.“
Passiert selten, aber passiert. Einem Weihnachtsrezept fehlte der Zucker, endlose Entschuldigungen und Richtigstellungen folgten. Häufiger aber sind Kommentare wie dieser: „Hallo, Nigel. Wir sind in unserer Ehe zu dritt. Meine Frau nimmt immer ein Buch von dir mit ins Bett.“ Eine englische Leserin fertigte ein Gesamtverzeichnis aller jemals erschienenen Slater-Rezepte an, „was für mich ausgesprochen praktisch war“. Eine japanische Leserin schickte Alben mit den Fotos aller Slater-Rezepte, die sie zubereitet und mit ihren eigenen Kommentaren versehen hatte. „Diese Bücher gehören zu meinen kostbarsten Besitztümern.“ Slater kocht jeden Tag. Er kocht, weil er muss, und er kocht, weil er will. Jeden Abend führt ihn sein letzter Weg vor dem Schlafengehen zum Kühlschrank, um nach dem Rechten zu sehen – und einen letzten Bissen zu nehmen.
„Eine Fingerspitze voller Hummus, ein Löffel kalter Pflaumencrumble oder, Freude aller Freuden, ein kaltes Würstchen neben dem Senfglas.“ So beschreibt Slater die sündige Freude, die er sich täglich gestattet, in A Cook’s Book.
„Heute Abend wird es ein Stück Schokoladekuchen sein, vielleicht so groß“ – er zeigt mit Daumen und Zeigefinger einen Abstand von vielleicht zwei oder drei Zentimetern an –, und ich fühle mich ertappt, weil ich mir gerade überlegt habe, ob ich gleich draußen auf der Straße anfangen soll, meine Doggybags zu plündern.
„Vielleicht auch noch ein kleiner Löffel von dem Rahm“, sagt Nigel, der offenbar schon eine genau Vorstellung davon hat, wie er seinem Kühlschrank „Gute Nacht“ sagen möchte. Als ich später vom Trullo nach Hause komme, schicke ich ihm nochmal herzliche Grüße. Und verspeise dankbar sämtliche Reste, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. —

© Julian Broad / Eyevine / picturedesk.com

© Jonathan Lovekin / A Cook’s Book / DuMont Buchverlag




© Stefan Johnson

© Trullo